
Bohlenfernstraße im Stapeler Moor, Uplengen / Lkr. Leer
Älteste Fernstraßen
und vorrunische Zeichen
Wieder war ich auf Tour, wieder in Richtung Norden, abends gelangte ich nach Oldenburg, stellte meinen Mitsubishi-Colt auf einem ruhigen Parkplatz ab und begann mich für den Rest der Nacht darüber zu ärgern, dass es den Autobauern völlig gleichgültig zu sein scheint, wie ein erwachsener Mann in ihren Konstrukten zum verdienten Schlaf kommen soll, denn an ein Ausstrecken war ja nicht zu denken.
Morgens stand ich als Erster vor dem Museum für Naturkunde und Vorgeschichte. Ich musste sie gesehen haben, die Sonderausstellung „Wohin die Toten gehen - Kult und Religion der Steinzeit“ (Nov. 2000-April 2001). Beeindruckend, die Rekonstruktion des Vierradwagens aus dem 3. Jahrtausend vor Null. Perfekt gearbeitete eisenzeitliche Moorbohlenwege mit den beiden Kultzeichen der „Brückenheiligen“ (Abb. 2), Moorleichen und die erstaunlichen Funden des 4. und 3. Jahrtausends, die ein ausgeklügeltes Fernstraßennetz in Norddeutschland beweisen. Eine schöne Sammlung von Fundnachbildungen wurde hier anschaulich zusammengetragen. Unter anderem fand sich der Deckstein des Warburger Großsteingrabes (Kr. Höxter) ausgestellt, der aufgrund von Begleitfunden auf 2.974 v.0 zu datieren ist. Darauf sind einige Symbolzeichen zu finden, u.a. ein kleiner Ring als Sonnensymbol und ein U-förmiges Zeichen als Stier-Chiffre. Die beiden Sinnzeichen sind die frühen Vorläufer der 3. und 23. ODING-Rune, also unseres urdeutschen Schrift- und Sinnzeichensystems.
In Campemoor, nahe Osnabrück, liegen die weltweit ältesten bislang gefundenen von Menschenhand angelegten Wege („P 31“ gilt als ältester), sie verliefen durch einen Wald, überbrückten Hochmoorflächen von einer Sandinsel zur anderen; sie wurden geschaffen zwischen 4.835 u. 4.715 u. 4.100 vor 0. Fünf Wege und zwei Stege sind bisher freigelegt. Der „jüngste“ entstand um 2.900 v. 0. Seit Jahren werden hier Pfahlwege ausgegraben, die in früheren Jahrtausenden das Moor überqueren halfen. Auch der spätjungzeitliche Bohlenweg im Meerhusener Moor wurde 2.350 v.0 angelegt, ist möglicherweise noch bedeutend älter. Es handelt sich um einen Bohlendamm bei Aurich/Ostfriesland, welcher zu den ältesten befestigen Straßenbauten zählt. Er führt, mindestens drei km lang, von der Geestplatte in Nähe des Großsteingrabes von Tannenhausen über das Meerhusener Moor bis er wieder die nördlichen Geestsandböden erreicht. In der Breite maß er um 4 m, durchschnittlich jedoch rund 2,8 m. Die Maximalbreite war nötig, weil er von Wagen mit starren Achsen befahren wurde, die auf engeren Spurbreiten nicht manövrieren konnten. Bei seiner Freilegung wurden Teile des ältesten jemals entdeckten Rades gefunden.
Abb. 2 

Die norddeutschen steinzeitlichen Überlandwege, von vielen Kilometern Länge, waren sinnvoll und kunstfertig konstruierte Gebilde. Weil das Moor, je nach Niederschlagsmenge, immer in Bewegung ist, durfte der Straßenaufbau nicht unbeweglich sein. Unebene Untergründe wurden mittels Strauchwerk aufgefüllt. Den jeweils zwei langen parallel liegenden Baumstämmen in Fahrbahnrichtung wurden Querhölzer von Birke, Eiche und Erle aufgelegt, wofür insgesamt rund 120 Hektar Wald abgeholzt werden musste. Schichten von Flechtmatten, Torf und Heidesoden deckten die Bahn zwecks leichterer Befahrbarkeit ab. Die Ausgräber fanden 12 zerbrochene Achsen, Deichseln und Eichenräder von 70 bis 90 cm Durchmesser, deren Laufflächenbreite sechs cm aufwies. Die verwendeten Fahrzeuge besaßen eine Spurweite von 1,5 m. Sie wurden von Ochsen gezogen; mehr als 50 zwischen den Dammbohlen steckengebliebene Rinderhufe erzählen von dramatischen Wagentrecks über das Moor. Die Wagenreste stammen aus der Zeit von mindestens ca. 2.500 v.0. Wenn man bedenkt, dass die Indianer weder Räder noch Wagen kannten, als die ersten Europäer Amerika erreichten, kann man sich ein Bild von der weit vorauseilenden überlegenen Innovationskraft unserer eigenen Vorfahren machen.
Abb. 3 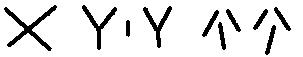
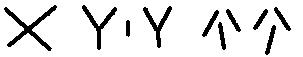
Südlich des Jadebusens u. Varel, zwischen Weser und Ems, finden sich Dutzende Bohlenwege. Die vorzüglichsten bestehen aus sehr ebnen, glatt geschlagenen Eichenbohlen, die an ihren Enden gelocht und durch Pflöcke mit den Unterbaulängsbalken so verfestigt sind, dass ein seitliches Verschieben unmöglich wurde. Auf den eisenzeitlichen Bohlen von Oltmannsfehn, nahe Wilhelmshaven, vom Jahre 713 v.0, fand man einige runenartige Symbole, deren Sinn und Zweck bisher unerschlossen blieb (Abb. 3). Bei dem rekonstruierten Abschnitt der Fahrbahn XLII (135 v.0) fand man zwei möglicherweise schützende Kultfiguren an riskanter Wegstrecke (Abb. 2), sowie eine aufrecht stehende warnende Verkehrszeichen-Bohle, deren eingearbeitetes Symbol. Der wissenschaftliche Kommentar dazu lautet: „Verblüffend ist, dass das heutige moderne Verkehrszeichen für Hinweise auf Bodenwellen oder Schlaglöcher recht ähnlich aussieht.“ (Archäol. Mitteilungen aus Nordwestdeutschland, 21/1998, S.48)
-o-o-o-o-o-o-o-o-
STEINZEIT-RUNEN ?
Gab es in der Steinzeit Schrift,
die Frage ist noch offen,
wenn man auch auf Zeichen trifft,
ist Klärung kaum zu hoffen.
Symbole hat man zwar gekannt,
das ist korrekt ersichtlich,
doch keinen runischen Verband,
der wurde spät geschichtlich.
Fernstraßen hat man da gebaut,
im Steinzeit-Ur-Germanien,
war mit dem Holzbau gut vertraut,
das war kein Schlendrianien.
Wer Straßen baut hat Ordnungskraft,
hält Recht und Ruh’ im Lande -;
der Ochsenkarren Güter schafft,
vom Dorf zum Nordseestrande.
Sinnzeichen gab’s also gewiss,
das ist nicht anders möglich,
geistig herrscht’ keine Finsternis,
die Leistung war höchst löblich !